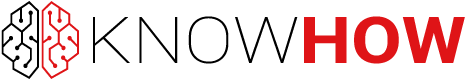Die Lebensmittelindustrie steht kurz vor einer bedeutenden Ernährungsumstellung, da die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln steigt. Dieser Artikel befasst sich mit dem komplexen Bereich der veganen Lebensmittelproduktion und analysiert die Herausforderungen und Strategien, die zur Erhaltung der Produktintegrität und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen eingesetzt werden.
Die grüne Revolution in der veganen Lebensmittelherstellung
Ein wachsendes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein hat in den letzten Jahren zu einem exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach veganen Produkten geführt, da immer mehr Menschen auf eine flexitarische, vegetarische oder vegane Ernährung umstellen. Die Art und Weise, wie „rein pflanzliche“ Lebensmittel vermarktet und wahrgenommen werden, hat sich daher dramatisch verändert.
Doch was gilt als „vegan“ oder „rein pflanzlich“? Die beiden Begriffe werden häufig austauschbar verwendet, wobei verschiedene Organisationen und Aufsichtsbehörden die Begriffe nach bestimmten Standards definieren. Um eine Täuschung der Verbraucher zu vermeiden, hat die Europäische Gemeinschaft eine Definition für einen „veganen Standard“ erarbeitet. Diese Definition wurde 2017 in Brüssel von grossen veganen Organisationen festgelegt und ist für die korrekte Kennzeichnung von Produkten in der Europäischen Gemeinschaft massgeblich.
Vegane Lebensmittelgesetzgebung

Da sie in der EU seit langem sicher verwendet werden, fallen die meisten pflanzlichen Bestandteile unter das normale Lebensmittelrecht und benötigen keine zusätzliche Vorabgenehmigung. Neue Waren oder Bestandteile können jedoch der Verordnung über Lebensmittelzusatzstoffe (EG Nr. 1333/2008) oder der Verordnung über neuartige Lebensmittel (2015/2083) unterliegen, die eine Zulassung durch die Europäische Kommission und eine Sicherheitsbewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erfordern.
Die Verordnung über neuartige Lebensmittel gilt auch für traditionelle pflanzliche Lebensmittel aus Ländern ausserhalb der EU, allerdings ist das Prüfungsverfahren schneller. Bestimmte rein pflanzliche Lebensmittel, insbesondere solche mit geschützten Angaben oder solche, die als neuartige Lebensmittel oder Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen sind, müssen nach dem EU-Rechtsrahmen strenge Anforderungen an die Zusammensetzung erfüllen.
Die Grauzone: Kennzeichnung und Rechtslage
Obwohl es „vegane“ Labels und Standards gibt, gibt es keine rechtsverbindliche Definition auf EU-Ebene. Das bedeutet, dass die Wahl der richtigen Produktpositionierung und Bezeichnung eine Herausforderung für Lebensmittelunternehmen darstellt. Dies gilt speziell für pflanzliche Milch- und Fleischalternativen. Ein Grossteil der Verordnungen zielt darauf ab, den Missbrauch geschützter Angaben zu verhindern und die von der Milch- und Fleischindustrie traditionell verwendete Terminologie zu schützen.
Da es keine rechtsverbindliche Definition für vegane Produkte gibt und auch anhand der Zutatenliste nicht erkennbar ist, ob ein Produkt vegan ist, gibt es einige Gütesiegel verschiedener Organisationen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Beispiele hierfür sind das V-Label, eine international geschützte Marke zur Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln, und die Veganblume der Vegan Society England.
Herstellungsrichtlinien für vegane Produkte

Beide Gütesiegel weisen darauf hin, dass das Produkt keine tierischen Inhaltsstoffe oder Hilfsstoffe enthält und keine Tierversuche bei der Herstellung durchgeführt wurden. Allerdings können trotz sorgfältiger Produktion manchmal kleinste Mengen, nicht zur Rezeptur gehörende Stoffe, in das Produkt gelangen. Deshalb ist auf manchen Produkten der Hinweis „Kann Spuren von … enthalten“ oder „Enthält Spuren von …“, zu finden. Damit sichern sich Hersteller gegen Schadensersatzansprüche von Allergiker/innen ab. Spurenhinweise für tierische Zutaten bedeuten allerdings nicht, dass tatsächlich tierische Inhaltsstoffe im Endprodukt enthalten sind und dieses somit nicht mehr vegan ist. Sie machen nur auf mögliche Verunreinigungen aufmerksam, die in minimalem Umfang und produktionsbedingt zustande kommen können. Um die Integrität der veganen Produktionslinien zu bewahren, verlangen anerkannte vegane Siegel von den Herstellern Massnahmen, um mögliche Kreuzkontaminationen auf ein Minimum zu halten.
Diese Anforderungen sind je nach Label unterschiedlich. Während es beim V-Label einen Grenzwert für produktionsbedingte Spuren nicht veganer Produkte gibt, wird bei der Veganblume von Herstellern, die parallel auch nicht vegane Produkte herstellen, die gründliche Reinigung von Maschinen gefordert, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
Tests und Überprüfungen
Die Hersteller können verschiedene Prüfmethoden wählen, um sicherzustellen, dass ihre veganen Produkte frei von tierischen Inhaltsstoffen sind. In der Lebensmittelbranche werden häufig Tests zum DNA-Nachweis, zur Identifizierung von Wirbeltieren, Enzymimmunoassays (ELISA) und Lateral Flow Devices (LFD) eingesetzt. Jeder Test hat jedoch seine Grenzen und erfordert besondere Instrumente und finanzielle Überlegungen.
Etablierung der veganen Lebensmittelherstellung auf der Grundlage von Feststoffprogrammen
Vor der Einführung eines HACCP-Systems (Hazard Analysis and Critical Control Points) müssen vorbereitende Programme durchgeführt werden. Damit diese Programme eine Kontamination durch tierische Erzeugnisse wirksam verhindern können, sollten sie einer internen Prüfung, Risikobewertung und Verifizierung unterzogen werden.
- Zuverlässige Lieferanten: Die Herstellung veganer Lebensmittel erfordert zuverlässige Lieferanten. Bedenken hinsichtlich Kreuzkontaminationen können mithilfe von Audits und Fragebögen festgestellt werden.
- Bedrohungsanalyse und kritische Kontrollpunkte (TACCP): Der Verbraucherschutz steht an oberster Stelle. Deshalb sollte bei tierischen Inhaltsstoffen und Spuren von Allergenen Klarheit geschaffen werden.
- Reinigungsverfahren: Um Kreuzkontaminationen mit tierischen Stoffen zu vermeiden, sind validierte Reinigungsverfahren unerlässlich.
- Produkttrennung: Vegane Produkte sollten idealerweise in einer separaten Anlage hergestellt werden. Aber auch effiziente Methoden der Produkttrennung reichen schon aus, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- Produktplanung: Hersteller, die nicht auf vegane Produktlinien spezialisiert sind, können dennoch eine überlegte Produktplanung anwenden. Vegane Produkte sollten Vorrang vor Produkten haben, die nicht vegane Zutaten enthalten.
Die Herausforderung der Kreuzkontamination in der veganen Lebensmittelproduktion

Die grösste Herausforderung bei der Herstellung von veganen Lebensmitteln ist nach wie vor die Kreuzkontamination. Insbesondere in Betrieben, die parallel zu ihren nicht veganen Produkten vegane Produkte herstellen. Wenn diese Hersteller nicht mit einem anerkannten Vegan-Label zertifiziert sind, das Massnahmen gegen die Kreuzkontamination fordert, kann nicht garantiert werden, dass das Produkt wirklich frei von Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffen tierischen Ursprungs ist. Deshalb sollte es eine rechtsverbindliche Definition der Begriffe „vegan“ und „vegetarisch“ in der EU geben. Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die tierischen Ursprungs sind, müssen erkenntlich gemacht und Hersteller, die ihre Produkte als „vegan“ bewerben, sollten ausserdem verpflichtet werden, Kreuzkontaminationen ausschliessen zu können.
Kontrollmethoden für die Herstellung veganer Lebensmittel
Als Garantie für die Kunden, dass das Produkt den veganen Idealen entspricht, dienen Zertifizierungen von angesehenen Organisationen als Legitimationssiegel. Die grössten veganen Labels im deutschsprachigen Raum sind das V-Label, das in Kooperation mit der Europäischen Vegetarier Union (EVU) und deren Mitgliedsorganisationen aufgebaut wurde, die Veganblume, der englischen Vegan Society, das Vegan-Label der Veganen Gesellschaft Deutschland e. V. und das EcoVeg-Siegel von Veg Organic e. V.
Schulungsprogramme
Um etwaige Lücken in den derzeitigen Verfahren zur Lebensmittelsicherheit zu schliessen, sollten die Schulungsprogramme regelmässig aktualisiert werden. Alle Mitarbeiter, die im Produktionsprozess tätig sind, sollten umfassend geschult werden und wissen, wie wichtig die Einhaltung der veganen Standards ist. Dazu gehört die Aufklärung über mögliche Quellen von Kreuzkontaminationen, das Wissen um die Feinheiten bei der Beschaffung veganer Zutaten und die Bedeutung der Einhaltung strenger Verarbeitungsregeln. Häufige Schulungen können dazu beitragen, dass das Personal über die aktuellen Industrienormen und Gesetze informiert ist und diese Praktiken festigt.
Innovative Technologien
Die Effizienz und Genauigkeit der Qualitätskontrolle bei der Herstellung von veganen Lebensmitteln kann durch den Einsatz von Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen erheblich verbessert werden. KI kann für genaue Qualitätskontrollen eingesetzt werden, die gewährleisten, dass die Produkte stets den veganen Anforderungen entsprechen, sowie für prädiktive Analysen, die dazu dienen, mögliche Probleme in der Fertigungslinie vorherzusehen und die Verfahren zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Umweltkontrollen
Ausserdem muss sichergestellt werden, dass im Produktionsbereich die richtigen Umweltbedingungen herrschen. Dies bedeutet, dass Variablen wie Feuchtigkeit, Temperatur und Sauberkeit überwacht und gesteuert werden müssen, um jegliche mikrobiologische Kontamination zu verhindern, die die vegane Reinheit der Produkte gefährden könnte.
Fazit
Der Vormarsch veganer Produkte bedeutet einen Wandel der Lebensmittelproduktion. Die steigende Nachfrage nach rein pflanzlichen Produkten fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Kunden und Aufsichtsbehörden, um die Integrität der veganen Produkte gewährleisten und Kreuzkontaminationen vermeiden zu können.
Die Hersteller können die Echtheit und Qualität ihrer veganen Produkte garantieren, indem sie strenge Kontrollverfahren anwenden, umfassende Risikobewertungen durchführen und grossen Wert auf eine transparente Kennzeichnung legen. Bei den Lebensmitteln der Zukunft wird nicht nur berücksichtigt, was wir essen, sondern auch der Produktionsprozess. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einer ethischeren, nachhaltigeren und gesundheitsbewussten Welt.